Ein besseres Verständnis der Schmerzmessung durch multimodale Beurteilung ist für die genaue Bewertung von Schmerzerfahrungen von entscheidender Bedeutung. Durch umfassende und vielfältige Ansätze zur Schmerzmessung wollen Forscher die diagnostische Präzision und die Wirksamkeit der Behandlung verbessern. Diese Studie befasst sich mit den komplizierten Methoden und Instrumenten zur Schmerzmessung und beleuchtet die Komplexität der Schmerzbeurteilung.
Table of Contents
Schmerz ist eine komplexe, subjektive Erfahrung, die ihre Wurzeln in der Neurobiologie hat und in hohem Maße von Wahrnehmung, Emotionen, kulturellem Kontext und kognitiver Interpretation geprägt ist. Die Selbstauskunft der Patienten ist zwar nach wie vor der Eckpfeiler der Schmerzbeurteilung, unterliegt aber naturgemäß Einschränkungen durch Sprache, Gedächtnis und individuelle Ausdrucksfähigkeit.
Es ist unwahrscheinlich, dass es jemals ein objektives Maß für Schmerzen geben wird, da die Schmerzerfahrung im Wesentlichen eine persönliche ist. Ein Reiz, der für die eine Person nur leicht unangenehm ist, kann für eine andere Person äußerst schwächend sein, was die große interindividuelle Variabilität bei der Wahrnehmung, Bewertung und dem Ausdruck von Schmerz verdeutlicht.
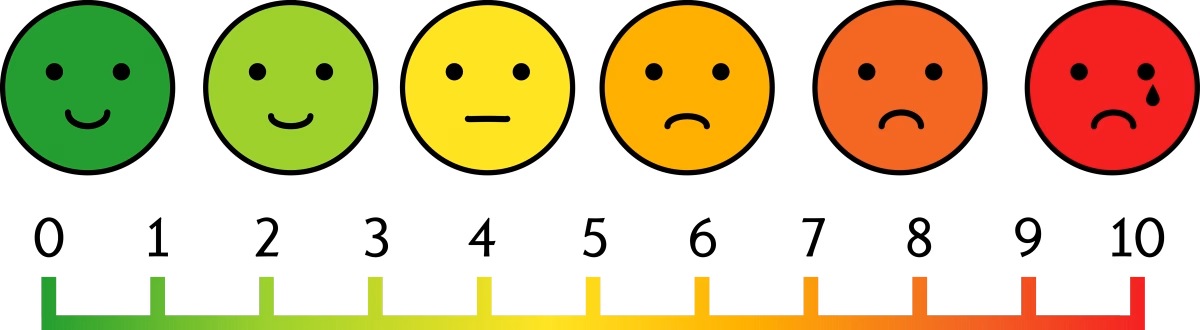
Die kontinuierlichen Fortschritte in der multimodalen Biosensorik haben jedoch neue Wege der Schmerzbeurteilung eröffnet, die physiologische, verhaltensbezogene und neurologische Signale integrieren, um auf das Vorhandensein und das Ausmaß von Schmerzen zu schließen.
Dieser Artikel befasst sich mit den Forschungsanwendungen der objektiven Schmerzmessung mit iMotions, einer Softwareplattform zur Synchronisierung und Analyse multimodaler Daten von Biosensoren.
Das ontologische Problem des Schmerzes
Schmerz ist kein einzelnes Signal, sondern ein komplexer entstehender Zustand. Er kann in einigen Fällen aus der Nozizeption (der Erkennung schädlicher Reize) entstehen, beinhaltet jedoch eine übergeordnete Verarbeitung, die dieses Signal in eine bewusste, emotional aufgeladene Erfahrung verwandelt. Die neurowissenschaftliche Forschung zeigt, dass Schmerzen nicht auf ein „Schmerzzentrum“ beschränkt sind, sondern über ein dynamisches Schmerzkonnektom verteilt sind, das den anterioren cingulären Cortex (ACC), die Insula, den Thalamus, den somatosensorischen Cortex und den präfrontalen Cortex umfasst.
Diese verteilte Natur macht es schwierig, Schmerzen in einem rein biologischen Sinne zu isolieren. Nach Angaben der International Association of Pain können Schmerzen mit einer tatsächlichen oder potenziellen Gewebeschädigung (nozizeptiver Schmerz), mit einer Nervenschädigung(neuropathischer Schmerz) oder sogar ohne eindeutige Anzeichen einer Gewebe-/Nervenschädigung(nociplastischer Schmerz) auftreten.
Jeder Versuch, Schmerz zu messen, muss daher die Multidimensionalität berücksichtigen – einschließlich physiologischer Erregung, affektiver Äußerung, kortikaler Aktivität und Verhaltensleistung.
Das Argument für multimodale Schmerzmessung
Um Schmerz als ein nahezu messbares Phänomen zu betrachten, müssen wir mehrere Modalitäten miteinander verbinden. Die iMotions-Plattform bietet eine synchronisierte Integration mehrerer Biosensoren, die jeweils unterschiedliche Dimensionen der Schmerzerfahrung erfassen:
| Modalität | Maßnahmen | Rolle bei der Erkennung von Schmerzen |
| Gesichtsausdruck (Affectiva) | Aktionseinheiten (FACS) | Erkennt unwillkürliche Äußerungen im Zusammenhang mit Schmerzen |
| Elektrodermale Aktivität (EDA) | Hautleitwert | Spiegelt die Erregung des Sympathikus aufgrund von Schmerzen wider |
| Herzfrequenz und Herzrhythmusvariabilität (HRV) | Kardiovaskuläre Reaktivität | spiegelt die schmerzbedingte Modulation der zeit- und frequenzbasierten Herzfrequenzvariabilität wider |
| Elektromyographie (EMG) | Aktivierung der Muskeln | Quantifizierung der Muskelkraft (in der Regel reduziert, wenn eine betroffene Gliedmaße oder ein Körperteil unter Schmerzen leidet), Muskelspannung |
| Eye Tracking | Pupillenerweiterung, Fixierungen | Schließt von Schmerzen auf Erregung und kognitive Belastung |
| Elektroenzephalographie (EEG) | Kortikale Aktivität | Erfasst die kognitive und sensorische Schmerzverarbeitung |
| Funktionelle Nahinfrarotspektroskopie (fNIRS) | Hämodynamische Reaktionen | Indirekte Veränderungen der kortikalen Aktivität |
iMotions synchronisiert diese Ströme automatisch und bietet den Forschern einen zusammengesetzten, zeitlich aufgelösten Überblick darüber, wie sich Schmerzen im Körper und im Gehirn manifestieren.
Analyse der Gesichtsmimik: Schmerz im Gesicht lesen
Der vielleicht intuitivste Indikator für Schmerz ist das menschliche Gesicht. Gesichtsausdrücke von Schmerz sind evolutionär konserviert und können sogar bei Säuglingen und nicht-verbalen Personen erkannt werden. Mit Hilfe von FACS (Facial Action Coding System) wurden bestimmte Aktionseinheiten (AUs) wie das Senken der Augenbrauen (AU4), das Zusammenziehen der Augenhöhlen (AU6/7), das Falten der Nase (AU9) und das Anheben der Oberlippe (AU10) mit akuten Schmerzepisoden in Verbindung gebracht.

iMotions bietet durch die Integration mit Affectivas AFFDEX-Software eine automatische AU-Erkennung in Echtzeit. Im Gegensatz zur manuellen FACS-Kodierung, die zeitintensiv ist, ermöglicht dies eine skalierbare Analyse über Stunden von Videos und bietet eine Quantifizierung von:
- Häufigkeit von schmerzbedingten AUs
- Dauer der Ausdrücke
- Muster des gleichzeitigen Auftretens (z. B. Augenbrauen- und Augenlidregionen beim Einstechen der Nadel)
Diese Daten können mit Stimulusereignissen und physiologischen Veränderungen korreliert werden, um Schmerzreaktionen zu validieren.
Elektrodermale Aktivität (EDA): Das Stresssignal des Körpers erfassen
Die EDA ist ein Maß für den Hautleitwert, der durch die Aktivität der ekkrinen Schweißdrüsen moduliert wird, die wiederum durch das sympathische Nervensystem gesteuert wird. Schmerzreize – insbesondere akute, unerwartete – lösen phasische Hautleitfähigkeitsreaktionen (SCRs) aus.
In iMotions werden EDA-Daten von Sensoren wie Shimmer, BIOPAC und Plux zusammen mit Stimulus-Ereignissen visualisiert, was es den Forschern ermöglicht, diese zu erkennen:
- Analysieren Sie die Spitzenamplituden und die Latenzzeit nach dem Stimulus
- Visualisierung von tonischen und phasischen Komponenten
- Gewöhnung an wiederholte Schmerzexposition abbilden
EDA ist besonders wertvoll in experimentellen Paradigmen, die eine kontrollierte Schmerzinduktion beinhalten (z. B. Cold Pressor Test, elektrische Stimuli), bei denen die Zeitsperre entscheidend ist.
Neuronale Signaturen des Schmerzes
Die Elektroenzephalographie (EEG) und die funktionelle Nahinfrarotspektroskopie (fNIRS) ermöglichen einen nicht-invasiven Einblick in die Verarbeitung schmerzhafter Reize durch das Gehirn.
EEG:
Die Elektroenzephalografie (EEG) ist eine weit verbreitete Methode zur Messung der Hirnaktivität sowohl in experimentellen als auch in klinischen Schmerzsituationen. Sie zeichnet Spannungsschwankungen direkt von der Kopfhaut auf und wird zur Untersuchung neuronaler Reaktionen eingesetzt, um Gehirnmuster zu ermitteln, die mit verschiedenen Aspekten des Schmerzes in Verbindung stehen, z. B. sensorische Verarbeitung, Aufmerksamkeit, Kognition, Auswirkungen von Schmerzbehandlungen und anderes mehr.

Bei der EEG-Analyse im Ruhezustand wurde die Alpha-Suppression mit der Reizintensität im sensomotorischen Kortex und dem Grad der Erregung in operculoinsulären Bereichen in Verbindung gebracht. Bei Patienten mit anhaltenden Schmerzen wurden im präfrontalen und anterioren cingulären Kortex verstärkte Theta-Oszillationen festgestellt, im Gegensatz zu gesunden, schmerzfreien Kontrollpersonen, was möglicherweise auf die kognitiven Aspekte von Schmerzen und die endogene Schmerzhemmung zurückzuführen ist.
Die Gamma-Band-Synchronisation wurde in der Vergangenheit mit der wahrgenommenen Schmerzintensität in Verbindung gebracht, aber kontroverse Ergebnisse rechtfertigen weitere Forschungen durch hochgradig kontrollierte Experimente, um die Auswirkungen von bewegungsbedingten Störfaktoren zu vermeiden.
iMotions unterstützt die Integration mit verschiedenen EEG-Systemen, insbesondere von Brain Products, Neuroelectrics Enobio, ABM B-Alert und generell mit jedem EEG-Gerät, das den Lab Streaming Layer unterstützt:
- Leistungsspektraldichte (Delta, Theta, Alpha, Beta, Gamma): Analyse der kortikalen Oszillationen bei Schmerzen
- Längsschnittliche Verfolgung neuroplastischer Veränderungen bei chronischen Schmerzpatienten
Jüngste Studien, die EEG mit iMotions verwenden, haben begonnen, Vorhersagemodelle für subjektive Schmerzbewertungen zu erforschen und damit die Tür zu einer KI-gestützten Diagnose zu öffnen.
Einige Veröffentlichungen mit iMotions
Alpha-Oszillationen bei chronischen Schmerzpatienten mit iMotions
fNIRS:
fNIRS ist eine Technik zur Messung der Hirnfunktion durch Überwachung der Verschiebungen des Oxyhämoglobins, das als indirekter Indikator für die kortikale Aktivität dient. Im Gegensatz zur funktionellen Magnetresonanztomographie (fMRI) bietet die fNIRS Vorteile in Bezug auf Tragbarkeit, Kosteneffizienz und die Möglichkeit, den Probanden eine natürlichere Bewegung zu ermöglichen.
Eine Meta-Analyse, in der 13 verschiedene Studien untersucht wurden, liefert überzeugende Beweise für die Reaktion des Gehirns auf schmerzhafte Reize sowohl bei chronischen Schmerzpatienten als auch bei gesunden Kontrollpersonen. Die Analyse ergab einen signifikanten Anstieg der Oxyhämoglobinwerte sowohl im präfrontalen als auch im sensomotorischen Kortex, wenn die Personen Schmerzen erlebten; der Effekt war jedoch im sensomotorischen Kortex stärker ausgeprägt.
Die Meta-Analyse ergab deutliche hämodynamische Veränderungen auf schädliche Reize bei Personen mit chronischen Schmerzen im Vergleich zu gesunden Kontrollgruppen. Diese Ergebnisse bestätigen insgesamt die Wirksamkeit der fNIRS als Instrument zur Messung der Auswirkungen von Schmerzen auf diese spezifischen Gehirnregionen.
iMotions-Links für EEG- und fNIRS-Material
EEG vs. fNIRS: https://imotions.com/blog/learning/research-fundamentals/fnirs-vs-eeg/
EMG und HR/HRV: Somatische und autonome Korrelate
Schmerzen reduzieren oft die Muskelkraft des betroffenen Körperteils und führen zu Muskelverspannungen, insbesondere im Corrugator supercilii (Stirnrunzeln) oder Trapezius (Nackenverspannung). iMotions berechnet verschiedene EMG-Analysen, um unter anderem festzustellen, wie viele und wie oft Muskelkontraktionen durchgeführt werden.
Herzfrequenz (HR) und Herzfrequenzvariabilität (HRV) bereichern den Datensatz zusätzlich. Die Herzfrequenz steigt bei Schmerzen tendenziell an, während die HRV – insbesondere die hochfrequenten Komponenten – tendenziell abnimmt, was den vagalen Entzug widerspiegelt.
Mit iMotions können die Forscher visualisieren:
- HR-Beschleunigung bei schmerzhaften Ereignissen
- HRV-Unterdrückung bei kurz- und langanhaltenden Schmerzen
Erholungskurven nach der Intervention (z. B. Analgesie)
Blickverlauf
Pupillometrie
Die Pupillometrie, d. h. die Messung des Pupillendurchmessers, ist sowohl in experimentellen als auch in klinischen Schmerzsituationen ein Forschungsinstrument zur Bewertung der schmerzbedingten Erregung, da sie in direktem Zusammenhang mit der Aktivität des autonomen Nervensystems, insbesondere der Aktivierung des Sympathikus, steht. Wenn Menschen Schmerzen empfinden, löst die daraus resultierende physiologische Stressreaktion den Ausfluss des Sympathikus aus, was zu einer Zunahme der Pupillenerweiterung führt.
Auf diese Weise können Forscher die Intensität der aversiven emotionalen und physiologischen Reaktion auf schädliche Reize messen, selbst wenn keine explizite verbale Berichterstattung erfolgt, wie z. B. bei Bevölkerungsgruppen, bei denen die verbale Kommunikation eingeschränkt ist (Säuglinge, schwerkranke Patienten oder Personen mit kognitiven Beeinträchtigungen).

Der Pupillendurchmesser wird nicht nur durch Schmerzen, sondern auch durch zahlreiche andere Faktoren beeinflusst, z. B. durch die Helligkeitsverhältnisse (Schwankungen der Helligkeit können die Pupillengröße unabhängig von der Erregung direkt beeinflussen, so dass eine kontrollierte und gleichmäßige Beleuchtung unerlässlich ist), durch Medikamente und Kaffeekonsum (verschiedene Medikamente wie Opioide, Alkohol und bestimmte Antidepressiva können die Pupillengröße direkt beeinflussen), durch die visuelle Akkommodation (Veränderungen des Blicks oder der Fokussierung zwischen nahen und fernen Objekten können zu einer Verengung oder Erweiterung der Pupillen führen) und durch individuelle Unterschiede (das Ausmaß der Pupillenreaktion auf Schmerzen kann ebenfalls von Person zu Person erheblich variieren, so dass es schwierig ist, universelle Schwellenwerte für die Schmerzintensität festzulegen).
Obwohl die Pupillometrie vielversprechend ist, muss sie daher häufig mit anderen physiologischen oder verhaltensbezogenen Messungen kombiniert werden, um ein umfassendes Verständnis der Schmerzintensität zu erhalten.
Fixierung/sakkadische Metriken
Wie sich Schmerzen auf die Aufmerksamkeit und die Informationsverarbeitung auswirken, kann mit Hilfe von bildschirmgestützten Eyetrackern und Eyetracking-Brillen untersucht werden. In einer im Journal of Pain veröffentlichten Studie wurde mit Hilfe von bildschirmgestützten Eyetrackern gezeigt, dass eine schädliche Stimulation eine Neuausrichtung der Aufmerksamkeitsressourcen auslöst, die sich in weniger sakkadischen Bewegungen und längerem Fixieren auf die Schmerzquelle äußert. Die Bewertung von Augenbewegungen scheint eine wertvolle ergänzende Methodik zur Erforschung schmerzbedingter Veränderungen der Aufmerksamkeit und ihres Beitrags zur Modulation von Schmerzen zu bieten.
Eine systematische Überprüfung von 24 Veröffentlichungen zeigt, dass die Effektgröße der Aufmerksamkeitsverzerrung gegenüber prädiktiven Hinweisen auf Schmerzen viel größer ist als die von schmerzbezogenen Wörtern und Bildern. Diese Ergebnisse werfen ein Licht auf die Erstellung relevanter schmerzbezogener Eye-Tracking-Studien.
iMotions bietet sowohl Standard- als auch fortgeschrittene Umfragetools, um die Antworten auf alle Arten von affektiven, kognitiven und Schmerzkatastrophen-Fragebögen, visuelle Analogskalen für die Bewertung der Schmerzintensität u.a. über den neuen iMotions 10 Study Builder zu erstellen und zu protokollieren
Auf dem Weg zu einem zusammengesetzten Schmerzindex
Die Zukunft der Schmerzerfassung liegt nicht in der Auswahl eines einzelnen Biosensors, sondern in der Erstellung eines multimodalen Schmerzindexes – einermaschinenlerngesteuerten Ausgabe, die gewichtet und integriert wird:
- Gesichtsausdruck
- Autonome Signale (EDA, HR)
- EEG-Muster
- Verhaltenskorrelate
iMotions unterstützt den Datenexport für die statistische und künstliche Modellierung. Dies ermöglicht es Forschern, maßgeschneiderte Modelle zu entwickeln, die auf ihre Populationen und Forschungsfragen zugeschnitten sind.
Beispiel: In einer kürzlich durchgeführten Studie wurde ein Random-Forest-Klassifikator auf synchronisierte EDA-, Gesichts-AU- und EEG-Merkmale trainiert, um selbstberichtete Schmerzwerte mit einer Genauigkeit von über 80 % vorherzusagen. Lesen Sie hier darüber.
Die iMotions-API ermöglicht die Echtzeit-Synchronisation externer Signale und das Streaming unverarbeiteter Rohdaten an externe Engines (z. B. Python, R, MATLAB), falls gewünscht.


